Download Infobrief Gesundheit und Steuern (PDF) | Archiv

Was ändert sich bei Gesundheit und Pflege in 2024? Hier ein Überblick.
Erhöhung der Kinderkrankentage
Die Erhöhung der Kinderkrankentage soll Eltern dabei unterstützen, die Betreuung ihrer kranken Kinder zu gewährleisten. Sie ist Teil des Pflegestudiumstärkungsgesetzes, das am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Durch die Erhöhung der Kinderkrankentage von bisher 10 auf 15 Arbeitstage pro Kind und Elternteil wird es Elternteilen ermöglicht, ihre Kinder bis zu 15 Tage lang zu Hause zu betreuen, ohne ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
Für Alleinerziehende steigt die Anzahl der Kinderkrankentage von bisher 20 auf 30. Eltern können wählen, ob sie die Kinderkrankentage am Stück oder gestaffelt nehmen möchten.
Eigenanteile in der Pflege
Vollstationär versorgte Pflegebedürftige werden ab dem 1. Januar 2024 stärker entlastet. Die Pflegekasse übernimmt nun höhere Zuschläge auf den pflegebedingten Eigenanteil. Die Höhe des Zuschusses hängt davon ab, wie lange die pflegebedürftige Person bereits in Pflegeheimen lebt.
Für Pflegebedürftige im Pflegegrad 2, die seit mindestens 6 Monaten in einem Pflegeheim leben, beträgt der Zuschuss 100 EUR pro Monat.
Für Pflegebedürftige im Pflegegrad 3 = 150 EUR pro Monat, für Pflegebedürftige im Pflegegrad 4 = 200 EUR pro Monat. Für Pflegebedürftige im Pflegegrad 5 beträgt der Zuschuss 250 EUR pro Monat.
Gleichzeitig werden auch die Leistungsbeträge für ambulante Pflegesachleistungen, also häusliche Pflegehilfen durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste, um fünf Prozent angehoben.
Pflegeunterstützungsgeld für bis zu zehn Tage pro Jahr
Wer einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen unterstützen muss, hat ab 1. Januar pro Kalenderjahr Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld für bis zu zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person. Bislang war der Anspruch auf insgesamt bis zu zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person begrenzt.
Das Pflegeunterstützungsgeld beträgt 90 % des tatsächlich ausgefallenen Nettoverdienstes, maximal jedoch 70 % der Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung pro Tag. Somit ergab sich für 2023 ein maximales Pflegeunterstützungsgeld von etwa 114,78 EUR pro Tag.
Mehr Auskunftsansprüche für Pflegebedürftige
Mit dem neuen Pflegestudiumstärkungsgesetz werden die Auskunftsansprüche von Pflegebedürftigen erweitert.
Pflegebedürftige haben nunmehr einen Anspruch auf folgende Informationen von ihrer Pflegekasse:
• Über die Art, Umfang und Kosten der erbrachten Pflegeleistungen
• Über die Qualifikation der Pflegekräfte und die Personalbesetzung des Pflegeheims
• Über die Beschwerdemöglichkeiten
Das E-Rezept wird verpflichtend
Das E-Rezept wird ab dem 1. Januar 2024 verpflichtend für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden. Dies ist Teil des Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), das am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist.
Das vom Arzt digital ausgestellte E-Rezept kann auf folgende Weise eingelöst werden:
• Per App: Die App "E-Rezept" ist kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich. Mit der App können Patienten ihr E-Rezept einsehen, herunterladen und an eine Apotheke senden.
• Per E-Mail: Patienten können ihr E-Rezept auch per E-Mail an eine Apotheke senden.
• Per Ausdruck: Patienten können ihr E-Rezept auch ausdrucken und in einer Apotheke einlösen.
Gesundheits-ID für Versicherte
Die Gesundheits-ID ist eine digitale Identität für Versicherte. Sie soll es Versicherten ab 1. Januar 2024 ermöglichen, sich sicher in der Telematikinfrastruktur (TI) zu authentifizieren und verschiedene Gesundheitsanwendungen zu nutzen, wie z. B. die elektronische Patientenakte (ePA) oder das E-Rezept.
Die Gesundheits-ID wird von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt und ist für Versicherte freiwillig. Um sich für eine Gesundheits-ID zu registrieren, müssen Versicherte sich persönlich bei ihrer Krankenkasse legitimieren.
Die Gesundheits-ID besteht aus einem eindeutigen Identifikationsmerkmal (ID-Nummer), einem Passwort und einem Einmalpasswort (OTP). Das Einmalpasswort wird für die Authentifizierung in der TI verwendet.
Die Gesundheits-ID soll dann den Zugriff auf die ePA – eine digitale Akte, in der alle relevanten Gesundheitsdaten eines Versicherten gespeichert sind – ermöglichen. Mit der Gesundheits-ID können Versicherte ihre ePA einsehen und bearbeiten.
Mit der Gesundheits-ID können Versicherte ihr E-Rezept in einer Apotheke einlösen. Die gewünschten Ziele zur Einführung der Digitalisierung werden nur sehr langsam erreicht. Die technischen und organisatorischen Pannen und der höhere Zeitaufwand überlagern momentan schnelle Erfolgsaussichten.
Bezahlung beim Pflegestudium
Um das Pflegestudium attraktiver zu gestalten, erhalten Studierende in der Pflege ab Januar für die gesamte Dauer ihres Studiums eine angemessene Vergütung. Dabei wird die hochschulische Pflegeausbildung als duales Studium ausgestaltet. Künftig ist auch ein Ausbildungsvertrag vorgesehen.
Schnellere Anerkennung ausländischer Pflegekräfte
Mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz wurden die Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte vereinfacht und beschleunigt. So müssen ausländische Pflegekräfte nun nicht mehr alle Prüfungen und Module der deutschen Ausbildung wiederholen, sondern können ihre ausländische Ausbildung anerkennen lassen, wenn sie den Nachweis über eine vergleichbare Ausbildung erbringen.
Um die Anerkennung zu erleichtern, hat das Bundesverwaltungsamt eine neue Online-Anwendung namens „Anerkennungs-Finder“ entwickelt. Mit dem „Anerkennungs-Finder“ können ausländische Pflegekräfte schnell und einfach prüfen, ob ihre ausländische Ausbildung in Deutschland anerkannt wird.
Erleichterter Austausch von Kinderarzneimitteln
Der erleichterte Austausch von Kinderarzneimitteln (Teil des Pflegestudiumstärkungsgesetzes) soll die Versorgung von Kindern mit Arzneimitteln bei Lieferengpässen verbessern.
Durch den erleichterten Austausch können Apotheken bei Lieferengpässen von Kinderarzneimitteln ohne Rücksprache mit dem verschreibenden Arzt ein wirkstoffgleiches Arzneimittel in einer anderen Darreichungsform oder ein wirkstoffgleiches Fertigarzneimittel in gleicher Darreichungsform ausgeben.
Die Regelung gilt für alle Kinderarzneimittel, die in der Anlage 1 der Arzneimittel-Richtlinie aufgeführt sind. Die Anlage 1 enthält rund 350 Arzneimittel, die häufig bei Kindern eingesetzt werden.
Quelle: ARD/TS, BD,pflege.de
Das Bundesfinanzministerium hat sich mit einem Schreiben vom 10. Oktober 2023 zu vorangegangenen Urteilen des Bundesfinanzhof (V R 25/16 und XI R 23/19) geäußert und mit Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass klargestellt, wann eine Umsatzsteuerbefreiung von Laborleistungen, die außerhalb der Praxisräume des praktischen Arztes durchgeführt werden, erfolgen kann.
Damit eine Laborleistung von der Umsatzsteuer befreit ist, muss sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss im Rahmen einer Heilbehandlung erbracht werden.
• Sie muss von einem Unternehmer erbracht werden, der die Laborleistung im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit erbringt.
• Sie muss im Inland erbracht werden.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Laborleistung von der Umsatzsteuer befreit.
Die Umsatzsteuerbefreiung für Laborleistungen ist ein wichtiger Beitrag zur Senkung der Kosten für die Gesundheitsversorgung. Sie trägt dazu bei, dass die Kosten für die Behandlung von Krankheiten und Verletzungen für die Patienten und die Krankenkassen niedriger sind.
Quelle: BMF/BD
Anders als bei den Hausärzten soll es bei den Fachärzten durch die Reformpläne keine sogenannte Entbudgetierung bei den Honoraren geben.
Lauterbach will bei den Fachärzten durch einen fast vollständigen Verzicht auf sogenannte Arzneimittelregresse Entlastung schaffen. Demnach haften Ärzte bisher mit ihrem eigenen Einkommen dafür, wenn sie zu viele oder zu teure Medikamente verschrieben haben. Die Reform wird Lauterbach zufolge dazu führen, dass 80 % der bisherigen Regressfälle entfallen.
In einem Urteil vom 18. August 2023 hat das Finanzgericht Düsseldorf entschieden, dass die Bezugsgröße für die Gewerbesteuerbefreiung von Einrichtungen zur ambulanten Rehabilitation die Anzahl der in der Einrichtung insgesamt behandelten ambulanten Rehabilitationsfälle ist. Dies gilt auch dann, wenn eine solche Einrichtung neben – dem Bereich der medizinischen Rehabilitation zuzuordnenden – Leistungen der Erweiterten Ambulanten Physiotherapie (EAP) auch steuerlich nicht begünstigte allgemeine physiotherapeutische Leistungen erbringt.
Die Klägerin ist eine Einrichtung zur ambulanten Rehabilitation. Sie erbringt neben Leistungen der EAP auch allgemeine physiotherapeutische Leistungen.
Die Klägerin beantragte die Gewerbesteuerbefreiung für die EAP-Leistungen. Das Finanzamt lehnte die Befreiung ab, da die Klägerin nicht die erforderliche Anzahl von EAP-Leistungen erbringe.
Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klägerin Recht. Es stellte fest, dass die Bezugsgröße für die Gewerbesteuerbefreiung die Anzahl der in der Einrichtung insgesamt behandelten ambulanten Rehabilitationsfälle ist. Dies folge aus dem Wortlaut des § 33 Absatz 1 Nummer 1b Gewerbesteuergesetz (GewStG). Danach sind Einrichtungen zur ambulanten Rehabilitation von der Gewerbesteuer befreit, wenn sie "im überwiegenden Umfang Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erbringen".
Die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf ist wichtig für Einrichtungen zur ambulanten Rehabilitation, die neben EAP-Leistungen auch allgemeine physiotherapeutische Leistungen erbringen. Die Entscheidung bedeutet, dass diese Einrichtungen auch für die allgemeinen physiotherapeutischen Leistungen die Gewerbesteuerbefreiung beanspruchen können, wenn sie im überwiegenden Umfang Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erbringen.
Das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch vom Bundesfinanzhof (BFH) aufgehoben werden.
Quelle: FG Düsseldorf
Ein Zahnarzt, der als so genannter „Pool-Arzt“ im Notdienst tätig ist, geht nicht deshalb automatisch einer selbstständigen Tätigkeit nach, weil er insoweit an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnimmt. Maßgebend sind vielmehr – wie bei anderen Tätigkeiten auch – die konkreten Umstände des Einzelfalls. Dies hat der 12. Senat des Bundessozialgerichts entschieden und damit der Klage eines Zahnarztes stattgegeben (Aktenzeichen B 12 R 9/21 R).
Der klagende Zahnarzt hatte 2017 seine Praxis verkauft und war nicht mehr zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen. In den Folgejahren übernahm er überwiegend am Wochenende immer wieder Notdienste, die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisiert wurden. Sie betrieb ein Notdienstzentrum, in dem sie personelle und sächliche Mittel zur Verfügung stellte.
Der Zahnarzt rechnete seine Leistungen nicht individuell patientenbezogen ab, sondern erhielt ein festes Stundenhonorar. Die beklagte Deutsche Rentenversicherung Bund und beide Vorinstanzen sahen den Kläger wegen seiner Teilnahme am vertragszahnärztlichen Notdienst als selbstständig tätig an.
Demgegenüber hat der 12. Senat des Bundessozialgerichts entschieden, dass allein die Teilnahme am vertragszahnärztlichen Notdienst nicht automatisch zur Annahme einer selbstständigen Tätigkeit zwingt. Vielmehr ist auch dann eine Gesamtabwägung der konkreten Umstände vorzunehmen.
Danach war der Kläger wegen seiner Eingliederung in die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisierten Abläufe beschäftigt. Hierauf hatte er keinen entscheidenden, erst recht keinen unternehmerischen Einfluss.
Er fand eine von dritter Seite organisierte Struktur vor, in der er sich fremdbestimmt einfügte. Auch wurde der Kläger unabhängig von konkreten Behandlungen stundenweise bezahlt. Er verfügte bereits nicht über eine Abrechnungsbefugnis, die für das Vertragszahnarztrecht eigentlich typisch ist.
Dass der Kläger bei der konkreten medizinischen Behandlung als Zahnarzt frei und eigenverantwortlich handeln konnte, fällt nicht entscheidend ins Gewicht. Infolgedessen unterlag der Zahnarzt bei der vorliegenden Notdiensttätigkeit aufgrund Beschäftigung der Versicherungspflicht.
Der Mindestlohn erhöht sich ab dem 1. Januar 2024 auf 12,41 EUR je Zeitstunde. In einem weiteren Schritt wird der Mindestlohn zum 1. Januar 2025 auf 12,82 EUR je Zeitstunde erhöht.
Mit einer Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Januar 2024 gelten folgende Geringfügigkeitsgrenzen:
Für den Minijob beträgt die neue Grenze 538 EUR (bisher 520 EUR).
Für den Midijob (Übergangsbereich) liegt die neue Grenze zwischen 538,01 und 2.000 EUR (bisher zwischen 520,01 und 2.000 EUR).
Die Mindestlöhne für alle Beschäftigten in der Pflege
Der Pflegemindestlohn ist nach Qualifikationsstufe gestaffelt und gilt einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Der Pflegemindestlohn steigt in mehreren Schritten bis zum Jahr 2025. Ab dem 1. Mai 2024 beträgt er 15,50 EUR brutto je Stunde für Pflegehilfskräfte, 17,35 EUR für qualifizierte Pflegehilfskräfte und 20,50 EUR für Pflegefachkräfte.
Zum Jahreswechsel 2023/2024 werden im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums zahlreiche Änderungen wirksam. So auch bei der Vergütung ärztlicher Leistungen.
Neue Vergütung zur Förderung ambulanter Operationen
Um Anreize zu setzen, mehr ambulant zu operieren statt stationär, führt das BMG per Rechtsverordnung eine neue Vergütungsform ein. Diese spezielle sektorengleiche Vergütung in Form von Fallpauschalen – sogenannte „Hybrid-DRG“ – soll laut BMG Vertragsärzten und Krankenhäusern die gleiche Vergütung für bestimmte Eingriffe – egal ob sie ambulant oder stationär durchgeführt wurden – zusichern. Die Regelung gilt für fünf Leistungsbereiche und tritt vorbehaltlich der Verkündung der Rechtsverordnung zum 1. Januar 2024 in Kraft.
Quelle: Bundesgesundheitsministerium
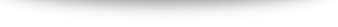
Swientek & Koitka GbR, Steuerberater
Im Grevelnkamp 13 | 59192 Bergkamen
Tel 02307 719987-0 | Fax 02307 719987-9
wk@stbsk.de | Routenplaner
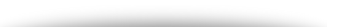
© Swientek & Koitka GbR, Steuerberater